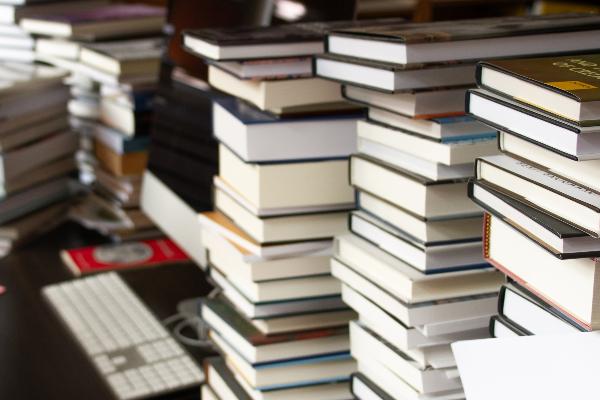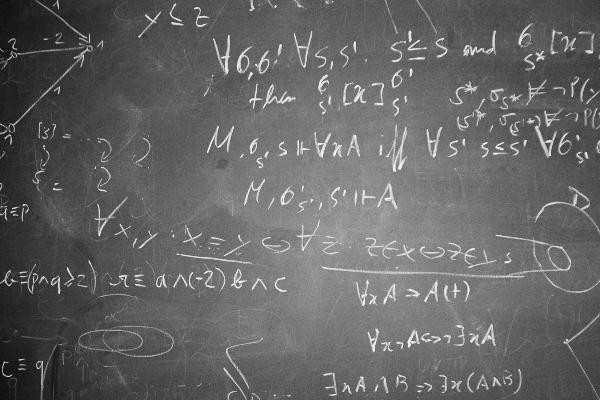Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie
Prof. Dr. Stephan Hartmann
Die Mitarbeitenden unseres Lehrstuhls forschen und lehren auf dem Gebiet der Wissenschaftstheorie. Die Aufgabe der Wissenschaftstheorie besteht darin, philosophische Fragen in Bezug auf die Wissenschaften zu stellen und zu beantworten. Mehr über unsere Arbeit erfahren Sie unter Profil des Lehrstuhls.
Unser Anliegen ist es, die Wissenschaftstheorie in voller Breite und Vielfalt – und in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Wissenschaftler – zu vertreten. Alle unsere Mitarbeitenden sind Mitglieder des Munich Center for Mathematical Philosophy (MCMP).
Leitung

Sekretariat
Kontakt & Adresse
Postanschrift
Ludwig-Maximilians-Universität München
Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft
Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München
Sekretariat/Besuchsadresse
Ludwigstr. 31/I
Raum 134 (Anmeldung im Sekretariat)
80539 München