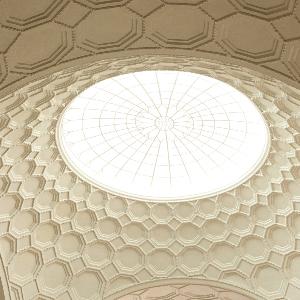
Fakultät und Lehrstühle
Die Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft vereint Lehre und Forschung in vielfältiger und einzigartiger Weise.
Profil der Fakultät
Die Fakultät vertritt das Fach Philosophie in seiner vollen Breite. Dazu gehören Schwerpunkte in der Geschichte der Philosophie (insbes. Antike Philosophie, Arabische Philosophie, Kant und Deutscher Idealismus), der Praktischen Philosophie (insbes. Entscheidungstheorie, Ethik, Ethik der Künstlichen Intelligenz, Handlungstheorie und Politische Philosophie) und der Theoretischen Philosophie (insbes. Erkenntnistheorie, Logik, Metaphysik, Philosophie des Geistes und Wissenschaftstheorie).
Hinzu kommen Forschungszentren wie das Munich Center for Mathematical Philosophy (MCMP) und das Zentrum für Ethik und Philosophie in der Praxis (ZEPP). Darüber hinaus arbeiten Mitglieder der Fakultät zu religionsphilosophischen Fragen sowie zu Themen aus der Religionswissenschaft.




















